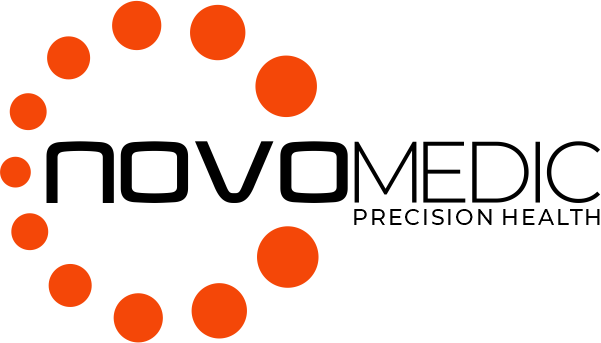Pharmakogenetik: Wie unsere Gene die Wirkung von Medikamenten beeinflussen

Die Einnahme von Medikamenten gehört für viele Menschen zum Alltag – sei es zur Behandlung chronischer Erkrankungen, akuter Beschwerden oder zur Vorbeugung von Krankheiten. Doch nicht alle Menschen reagieren gleich auf Medikamente: Während ein Medikament bei einer Person wie erwartet wirkt, kann es bei einer anderen starke Nebenwirkungen verursachen oder völlig wirkungslos bleiben. Die Pharmakogenetik, ein Teilgebiet der personalisierten Medizin, liefert Antworten auf diese Differenzen und zeigt, wie individuelle genetische Unterschiede die Wirksamkeit und Sicherheit von Medikamenten beeinflussen können.
In diesem Blogpost begleiten wir Gudrun, eine 61-jährige Patientin. Gudrun wurde kürzlich der Blutverdünner Warfarin verschrieben, doch sie hatte starke Nebenwirkungen. Viele Jahre früher erhielt Sie bei der Geburt Ihrer Tochter außerdem das Schmerzmittel Codein, aber verspürte die schmerzlindernde erst deutlich später als die andere Patientin im Kreissaal. Ihre Geschichte hilft uns, die Bedeutung der Pharmakogenetik besser zu verstehen.
Medikamente durchlaufen im Körper einen komplexen Prozess. Nach der Einnahme - sei es oral, intravenös oder in einer anderen Form - gelangen sie über den Blutkreislauf zu ihrem Zielorgan. Dort entfalten sie ihre Wirkung, indem sie bestimmte biochemische Prozesse beeinflussen oder blockieren. Diese Wirkungsweise ist jedoch nur ein Teil des Gesamtprozesses.
Wie Medikamente im Körper wirken
1. Aufnahme und Verteilung
Nach der Einnahme eines Medikaments beginnt die Resorption, bei der der Wirkstoff in den Blutkreislauf aufgenommen wird. Von dort wird es durch den Körper transportiert und erreicht sein Zielorgan. Die Wirkungsintensität eines Medikaments hängt oft von seiner Konzentration im Blut ab, die wiederum durch die Dosierung und die Geschwindigkeit der Aufnahme beeinflusst wird.
2. Metabolisierung
Nachdem das Medikament seine Aufgabe erfüllt hat, beginnt der Metabolisierungsprozess in der Leber. Dort werden Medikamente durch Enzyme wie die Cytochrom-P450-Familie verarbeitet. Für Prodrugs - inaktive Medikamente - ist die Metabolisierung essenziell, da diese erst durch die Enzyme in ihre aktive Form umgewandelt werden müssen.
Ein Beispiel ist Codein, ein Prodrug, das in Morphium umgewandelt wird, um seine schmerzlindernde Wirkung zu entfalten. Wenn Enzyme wie CYP2D6 nicht richtig funktionieren, bleibt Codein inaktiv und der Anwender / die Anwenderin wird nicht von der schmerzlindernden Wirkung profitieren.
3. Abbau und Ausscheidung
Die letzte Phase der Medikamentenwirkung ist die Ausscheidung. Nachdem das Medikament in der Leber wieder inaktiviert/abgebaut wurde, kann es über die Nieren oder die Galle aus dem Körper entfernt werden. Ein reibungsloser Abbau ist wichtig, um eine Anreicherung von Medikamenten im Körper zu vermeiden, die zu toxischen Konzentrationen führen kann.
Bei Gudrun führte ein genetischer Defekt im zuständigen Abbauenzym dazu, dass der Blutverdünner langsamer als üblich verarbeitet wurde, was die Nebenwirkungen erklärte.
Aktivierung von Wirkstoffen (Pro-Drugs)
Pro-Drugs sind eine besondere Klasse von Medikamenten, die in ihrer verabreichten Form inaktiv sind. Sie entfalten ihre Wirkung erst, nachdem sie im Körper durch spezielle Enzyme in ihre aktive Form umgewandelt wurden.
Beispiel: Codein
Codein wird durch das Enzym CYP2D6 in Morphium umgewandelt.
-
Extensive Metabolizer: Menschen mit normaler Enzymaktivität wandeln Codein in einer ausgewogenen Menge in Morphium um, sodass es eine effektive Schmerzlinderung bietet.
-
Ultra-Rapid Metabolizer: Bei diesen Personen arbeitet CYP2D6 übermäßig aktiv. Dies führt dazu, dass Codein schnell und in großen Mengen in Morphium umgewandelt wird. Die Folge können gefährlich hohe Morphiumkonzentrationen sein, die sogar bei den Neugeborenenen von Schwangeren tödlich sein können.
-
Intermediate Metabolizer: Bei diesen Menschen ist die Umwandlung von Codein in Morphium verlangsamt, was zu einer schwächeren Schmerzlinderung führen kann.
-
Poor Metabolizer: Bei diesen Personen ist die Enzymaktivität so stark eingeschränkt, dass Codein kaum oder gar nicht in Morphium umgewandelt wird. Das Medikament bleibt somit weitgehend wirkungslos.
Der Abbau von Medikamenten: Gefahr durch genetische Defekte
Nachdem ein Medikament seine Wirkung entfaltet hat, wird es im Körper abgebaut, um ausgeschieden werden zu können. Dieser Prozess ist essentiell, um zu verhindern, dass sich Wirkstoffe im Körper anreichern und toxische Konzentrationen erreichen. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem jene Gene, die für den Abbau von Medikamenten verantwortlich sind. Diese Gene kodieren für Enzyme, die unterschiedlich aktiv sein können - deswegen spricht man je Enzym von unterschiedlichen "Metabolizer-Typen":
- Extensive Metabolizer (normaler Abbau): Die Enzymaktivität ist normal und der Abbau oder die Aktivierung von Medikamenten erfolgt daher ebenfalls in normaler Geschwindigkeit.
-
Ultra-Rapid Metabolizer (schneller Abbau): Die Enzymaktivität ist beschleunigt und der Abbau oder die Aktivierung erfolgt daher schneller als vorgesehen.
-
Intermediate Metabolizer (langsamer Abbau): Die Enzymaktivität ist verlangsamt und der Abbau oder die Aktivierung ist daher langsamer als normal.
-
Poor Metabolizer (sehr langsamer Abbau): Der Enzymaktivität ist deutlich verlangsamt und die Abbau- oder die Aktivierungsgeschwindigkeit des Wirkstoffs liegt unter 30% der gewünschten Geschwindigkeit.
Ein gestörter Abbauprozess kann besonders bei langfristiger Medikamenteneinnahme problematisch werden. Bleibt ein Medikament zu lange im Körper, steigt das Risiko für Nebenwirkungen und toxische Reaktionen.

-1-1.png?width=450&height=363&name=Pro%20Drug%20Abbau%20gest%C3%B6rt%20(1)-1-1.png)
Beispiel: Warfarin, das Blutverdünnungsmittel, das Gudrun eingenommen hat, wird erheblich durch die Aktivität des Enzyms CYP2C9 beeinflusst. Menschen wie Gudrun, die eine genetische Variation aufweisen, die den Abbau verlangsamt, benötigen oft eine deutlich geringere Dosis, um das Risiko von Blutungen zu minimieren.
Gudrun wurde durch eine pharmakogenetische Analyse als Intermediate Metabolizer für das Enzym CYP2C9 identifiziert. Das bedeutet nicht, dass sie bei allen Medikamenten ein langsamer Verstoffwechsler ist, sondern dass sie spezifisch bei Warfarin eine reduzierte Enzymaktivität hat. Diese Erkenntnis half ihrem Arzt, die Dosierung anzupassen.
Transportproteine und Rezeptoren
Neben den Enzymen beeinflussen auch Transportproteine und Rezeptoren die Medikamentenwirkung. Transportproteine wie P-Glykoprotein (ABCB1) regulieren, wie viel eines Medikaments in die Zellen aufgenommen oder aus diesen ausgeschieden wird. Genetische Varianten können dazu führen, dass Medikamente zu schnell entfernt oder unzureichend aufgenommen werden.
Rezeptoren, an die Medikamente binden, spielen ebenfalls eine zentrale Rolle. Genetische Unterschiede können ihre Sensitivität verringern, wodurch Medikamente weniger effektiv sind. Ein Beispiel sind Beta-Blocker, deren Wirkung bei bestimmten Genvarianten der Beta-adrenergen Rezeptoren reduziert sein kann.
Pharmakogenetische Analyse: Wie sie funktioniert und wem sie hilft
Eine pharmakogenetische Analyse identifiziert genetische Variationen, die den Abbau, die Aktivierung und die Wirksamkeit von Medikamenten beeinflussen. Dies geschieht durch einen einfachen DNA-Test, der Aufschluss über relevante Gene gibt.
Nutzen der Analyse
- Personalisierte Dosierung: Medikamente können an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
- Nebenwirkungsreduktion: Risiken durch falsche Dosierung oder unwirksame Medikamente werden minimiert.
- Therapieoptimierung: Die Auswahl der Medikamente wird präziser und effektiver.
Wie der Bericht aufgebaut ist und wie Sie damit arbeiten, lesen Sie HIER!
Fazit
Die Pharmakogenetik zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, Therapien an die individuellen genetischen Gegebenheiten eines Patienten anzupassen. Sie erklärt, warum Standarddosierungen nicht immer ausreichen und wie genetische Unterschiede die Medikamentenwirkung beeinflussen. Dank moderner DNA-Analysen können Ärzte die richtige Wahl treffen, um die Wirksamkeit von Medikamenten zu maximieren und Nebenwirkungen zu minimieren.Gudrun konnte dank der Erkenntnisse aus der Pharmakogenetik sicherer und effektiver behandelt werden als zuvor. Ihre Geschichte zeigt, wie entscheidend ein personalisierter Ansatz in der Medizin ist.
Weitere Informationen zum Umfang der DNA-Analyse finden Sie hier.
Haben Sie noch Fragen?
Sehr gerne steht Ihnen unser Team bei Fragen oder anderen Anliegen jederzeit zur Verfügung. Zögern Sie bitte nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen - Sie erreichen uns telefonisch unter +43 6225 24822 oder per E-Mail an team@novomedic.com.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Umsetzen der genetischen Erkenntnisse und verbleiben mit ganz lieben Grüßen. Bleiben Sie gesund!
Ihr Team von NovoMedic